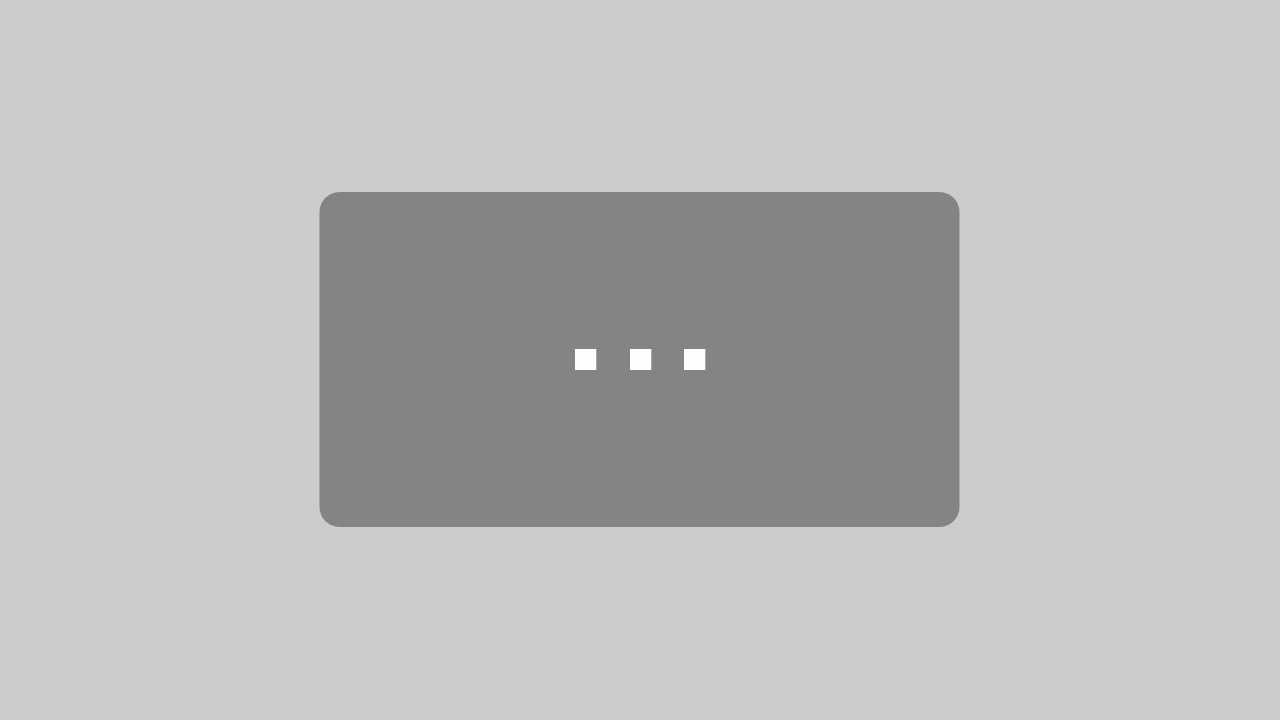Der Januar ist für uns immer ein Monat zur Neuausrichtung, zum Wagen neuer Projekte und zum Durchdenken von Ideen – auch in der Fütterung. Aus dem Januar machen wir also jedes Jahr den fodjanuar und tragen diesen Gedanken mit einer kleinen Vorteilsaktion zu Ihnen.
Alles zur fodjanuar-Aktion 2020

Dieses Jahr zieht der fodjanuar in die fodjan App ein: Vom 1.1. bis 31.1.2020 finden Sie in der fodjan App einen Aktionsbanner auf der Übersicht. Dort können Sie die App bewerten und dafür gratis für 3 Monate die Premium-Funktionen der App freischalten – z.B. mehr Rationsvorschläge, Auswertungen zur MLP etc. Alle Details dazu finden Sie in der fodjan App.
Noch unschlüssig, ob die fodjan App zu Ihnen passt? Warum sie sich lohnt, lesen Sie im Folgenden.
fodjan Neuigkeiten für 2020
Nachdem 2019 die Funktion zur Dokumentation von Kennzahlen zu Tieren, Milchleistung und Fütterung in fodjan eingezogen ist, wird es auch 2020 wieder neue spannende Funktionen geben, die das Fütterungsmanagement erweitern und erleichtern.
Gefütterte Mengen automatisch in fodjan
Die größte Neuerung 2020 werden die neuen Schnittstellen zu Futtermischwagen und Wiegesystemen sein. Damit lässt sich die geplante Fütterung noch besser mit den tatsächlich gefütterten Mengen vergleichen. Dies ist aktuell nur über die „Jetzt Füttern“-Funktion in der fodjan App möglich.
Die aktuell vorhandenen Schnittstellen zu Futtermischtechnik, mit denen bereits Rationen exportiert werden können, wie z.B. zu einem PTM-System oder dem DairyFeeder von BvL, werden damit erweitert. Nicht nur, dass die Daten rückführbar ins fodjan-System sein sollen, sondern zusätzlich werden auch weitere Anbieter an die Plattform angeschlossen. Neuigkeiten dazu erfahren Sie immer aktuell in unserem Blog oder auf unseren Profilen bei Facebook und Twitter.

Fütterungscontrolling: Futtereffizienz als neue Kennzahl
Mit der Erweiterung der Futtermischwagen- und Wiegetechnik-Schnittstelle wird es unter dem Punkt Auswertungen in fodjan Pro zukünftig auch einen neuen Menüpunkt geben – das Fütterungscontrolling. Aus der vorgelegten Futtermenge werden dort automatisch Übersichten zur Futtereffizenz (kg Milch / TM Aufnahme), Futteraufnahme sowie den Futterkosten erstellt. Im Rahmen des Forschungsprojekts ReMissionDairy, an dem fodjan mitwirkt, werden diese noch durch Übersichten zur Stickstoff- und Methanemission aus der Fütterung ergänzt (> Blogbeitrag zu ReMissionDairy).
Das Fütterungscontrolling lässt sich aktuell bereits als Beta-Version in fodjan Pro testen. Die Grundlage dafür bilden jetzt bereits die Zahlen, die in der Dokumentation (fodjan Pro und App) oder mit „Jetzt füttern“ (fodjan App) hinterlegt werden können.
Sie sind fodjan Pro-Nutzer und haben die App noch nicht getestet?

Die fodjan App ist gratis in Ihrer Lizenz enthalten. Zum Login brauchen Sie nur Ihre gewohnten Zugangsdaten von fodjan Pro. Probieren Sie es aus und schreiben Sie uns gern Ihr Feedback per E-Mail an feedback@fodjan.de.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Jahr 2020 und viel Erfolg bei der Fütterung!
Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback per Mail (feedback@fodjan.de) und Ihren Besuch bei uns auf Twitter oder Facebook.
Ihr fodjan Team.